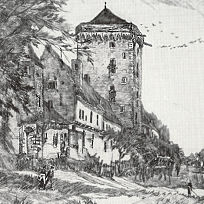 Vom 8. Juli 1932 ist die Urkunde datiert, die dem Landschaftsmaler und
Radierer Theo Blum aus Köln das Ehrenbürgerrecht der Stadt Zons verleiht. Theo
Blum wurde damit der erste Ehrenbürger unserer Stadt. Damals - 1932 - waren es fast drei Jahrzehnte her, dass der
Künstler unermüdlich, stets begeistert und in uneigennütziger Weise durch sein
künstlerisches Schaffen und seine lebendige Gestaltungskraft in zahlreichen
Zeichnungen, Radierungen, Aquarellen und Gemälden die Schönheiten unseres alten
und ehrwürdigen Zons den weitesten Kreisen bekannt gemacht hat.
Vom 8. Juli 1932 ist die Urkunde datiert, die dem Landschaftsmaler und
Radierer Theo Blum aus Köln das Ehrenbürgerrecht der Stadt Zons verleiht. Theo
Blum wurde damit der erste Ehrenbürger unserer Stadt. Damals - 1932 - waren es fast drei Jahrzehnte her, dass der
Künstler unermüdlich, stets begeistert und in uneigennütziger Weise durch sein
künstlerisches Schaffen und seine lebendige Gestaltungskraft in zahlreichen
Zeichnungen, Radierungen, Aquarellen und Gemälden die Schönheiten unseres alten
und ehrwürdigen Zons den weitesten Kreisen bekannt gemacht hat.
So erfolgte die erste Begegnung des Künstlers mit Zons genau vor sechs
Jahrzehnten, als im Jahre 1904 durch Königlich Preußische
Kabinettsorder Zons das neue Stadtwappen
verliehen wurde. Am festlichen Verlauf dieses
Ereignisses nahm damals Theo Blum mit vielen anderen „Düsseldorfer
Malkästlern“ regen Anteil, und es entstanden in dieser Zeit seine ersten
Arbeiten über Zons, die sich dann zwei Jahrzehnte später, im Jahre 1925,
in der einmaligen künstlerischen Aussage des bekannten und berühmten Gemäldes
„Sommertag in Zons“ verdichteten. Gerade dieses Gemälde, von dem Schweizer
Industriellen Winterhalter für seine Sammlung erworben und von dem Münchner
Verlag Hanfstaengel als farbiger Kunstdruck veröffentlicht, hat nicht zuletzt
mit dazu beigetragen, Zons mit seinen malerischen Bauten der Öffentlichkeit
näher zubringen.
Im Jahre 1923 wurde Theo Blum Ehrenmitglied des Zonser Verkehrsvereins, und
im Jahre 1929 übernahm er die künstlerische Durchführung des historischen
Festzuges und des Festprogramms des Zonser Stadtfestes aus Anlass der
555-Jahrfeier, ein Ereignis, an das sich viele, die damals dateigewesen, heute
noch gern erinnern.
Heute sind nun seit der Überreichung des Ehrenbürgerbriefes an Theo Blum wiederum
über drei volle Jahrzehnte ergangen, und auch in dieser Zeit ist der
Künstler der Stadt Zons immer verbunden geblieben und hat der alten ehemaligen
kurkölnischen Zollfeste stets die Treue gehalten und immer wieder neue Arbeiten
von Zons geschaffen. Aber auch die Stadt Zons hat immer gern die Gelegenheit
wahrgenommen, das künstlerische Werk ihres Ehrenbürgers in ihren Mauern
auszustellen. So geschah es zum letzten Male anlässlich der Zonser Festwochen
im August des Jahres 1951 und so geschieht es heute, wenn auch verspätet, aus
Anlass des 30. Geburtstages unseres Ehrenbürgers, den dieser am 10. Januar 1963
feiern konnte.
Die Besucher dieser Ausstellung und alle, die des Künstlers Liebe zum
ehrwürdigen Zons kennen, wie sie seit sechs Jahrzehnten ihren künstlerischen
Niederschlag in zahlreichen Arbeiten gefunden hat, werden sicherlich mit uns
der Meinung sein, dass, wenn nicht schon im Jahre 1932 das Ehrenbürgerrecht
verliehen worden wäre, man heute Theo Blum den Ehrenbürgerbrief anbieten
müsste.
LERCH (Bürgermeister)
ELICKER (Stadtdirektor)
Krefeld und der Niederrhein
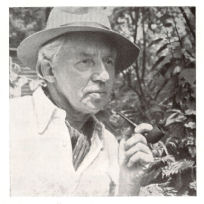 Theo Blum, den man zu den Altmeistern unter den rheinischen Malern zählen
darf, wurde am 10. Januar 1583 zwar in Mönchengladbach geboren, doch verbrachte
er die Jahre seiner Jugend in Krefeld. Dies mag für seine spätere künstlerische
Entwicklung nicht ohne Bedeutung und Einfluss gewesen sein. Von hier waren es
nur wenige Schritte in die weite Ebene der niederrheinischen Landschaft, die
oft vom Dunst der aufsteigenden Nebel verhangen erscheint, aber auch oft
ausgebreitet daliegt im silbrig schimmernden Sonnenglast, während breit die
Wasser des Rheines dem Meere zu eilen.
Theo Blum, den man zu den Altmeistern unter den rheinischen Malern zählen
darf, wurde am 10. Januar 1583 zwar in Mönchengladbach geboren, doch verbrachte
er die Jahre seiner Jugend in Krefeld. Dies mag für seine spätere künstlerische
Entwicklung nicht ohne Bedeutung und Einfluss gewesen sein. Von hier waren es
nur wenige Schritte in die weite Ebene der niederrheinischen Landschaft, die
oft vom Dunst der aufsteigenden Nebel verhangen erscheint, aber auch oft
ausgebreitet daliegt im silbrig schimmernden Sonnenglast, während breit die
Wasser des Rheines dem Meere zu eilen.
Das ist auch noch heute, da Schlote und Fördertürme auf der linken
Rheinseite schon weit landeinwärts vorgedrungen sind, eine Landschaft der
Stille, in der ebenfalls die Menschen keine lauten und unnützen Worte machen,
denn seit eh und je gelten hier Taten mehr als Worte. So ist auch der
Landschaftsmaler und Radierer Theo Blum ein Vertreter dieses niederrheinischen
Menschenschlages; ernst und dennoch einer vom Herzen kommenden Heiterkeit, die
oft auch derbe Späße schätzt, nicht verschlossen. Eines haben sie alle
gemeinsam, diese Menschen vom Niederrhein: die kleinen und großen Bauern und
mächtigen Hofbesitzer, die Handwerker und Arbeiter, die Fabrikanten und Industriellen,
die Lehrer, Gelehrten, Schriftsteller und Künstler - den unbändigen Stolz des
freien Mannes, der keine falsche Demut kennt, sodass auf keinen anderen
Menschenschlag
besser als auf diesen die Worte Ernst Moritz Arndts passen: Steh und falle mit
eigenem Kopfe, tu das Deine und tue es frisch!
- Besser stolz aus dem irdenen Topfe, als demütig am goldenen Tisch. Und
damit wäre auch der „Meister“ selbst, wie ihn die Freunde nennen,
charakterisiert.
Aber auch Krefeld sei nicht vergessen. Hier ertönte das Rattern der
Jacquard-Stühle, die Industrie blühte, und die Stadt wurde durch Seidengewebe
und Krawatten reich und reicher. Der Jugendstil war in Mode gekommen und es
galt, die florealen Ornament-Entwürfe in textile Gewebe umzusetzen. So standen
die Seidenstadt Krefeld und die niederrheinische Landschaft am Beginn der
künstlerischen Laufbahn von Theo Blum.
Die frühen Jahre
Doch nicht allein der textilen Gewebe hatte sich der in Mode gekommene
Jugendstil bemächtigt; alles, was nach Dekor verlangte und für Dekor geeignet
schien, wurde mit florealen Mustern überzogen. Und das war wahrlich nicht
wenig, da es das weite Gebiet der Außen- und Innenarchitektur über Möbel und
Glasfenster bis zur Keramik, Buchillustrationen und -Einbänden, Gold- und
Silberschmiedearbeiten usw. umfasste. Kein Wunder, dass die auf der Krefelder
Kunstgewerbeschule gedrillten Dessinateure auch diese Zweige ornamentalen
Gestaltens beherrschen mussten. So übte denn auch Theo Blum in dieser Zeit
fleißig und unverbissen die graphisch-symmetrische Umsetzung von gegebenen
Vorbildern aus den Bereichen der Botanik und der Zoologie. Rosen und Lilien
waren besonders beliebt, aber auch Schildkröte und Seepferd waren geschätzt;
letzteres in seiner besonderen Eignung als Gefäß-Henkel. Bei der Betrachtung
der frühen Studien und Entwurfszeichnungen ist man über die handwerkliche
Akribie erstaunt, mit der diese Arbeiten ausgeführt sind.
- Diese saubere handwerkliche Leistung ist
auch heute noch ein besonderes Kennzeichen für die Arbeiten des Künstlers, vor
allem begegnen wir ihr in den Kaltnadelradierungen.
Vor dem ersten Weltkrieg war es allgemein üblich, dass auf Fleiß - Ausstellungen und auf Ausstellungen -
Preise folgten. Bereits während seines Besuches der Krefelder
Kunstgewerbeschule (1900 - 1903) und in den anschließenden Jahren seiner
Tätigkeit als Dessinateur und Entwerfer für kunstgewerbliche Gegenstände errang
Theo Blum auf Ausstellungen und in Wettbewerben zahlreiche erste und zweite
Preise für Plakate, Glasfenster, Bucheinbände, Buchtitel Gold- und
Silberschmiedearbeiten (Orivit, Köln), keramische Wandplatten (Wessel, Bonn)
usw. usw. Ein gewonnener Wettbewerb, ein Preis war es dann auch, der Theo Blum
im Jahre 1903 nach Köln führte, das seine Wahlheimat werden sollte.
Der Weg zur Landschaft und zum Stadtbild
Es waren nicht allein das Ausklingen des Jugendstils und seiner immer mehr
zur Routine gewordenen und nach und nach erstarrten florealen Ornamente und
auch nicht der Anbruch des Expressionismus, die Theo Blum das so vielseitige
und von ihm praktizierte Gebiet eines kunstgewerblichen Dessinateurs aufgeben
ließen. Schon auf frühen Studienfahrten an den Niederrhein, nach Belgien,
Holland und in die Schweiz kam er mit der Landschaftsmalerei, die eine
besondere Sparte des damals noch herrschenden Akademismus war, in Berührung.
Bereits um das Jahr 1907 entstehen die ersten zeichnerischen Landschaftsstudien
und Aquarelle. Hier lassen der Sinn für das Wesentliche und die Leichtigkeit
der angewandten Aquarell-Technik, nicht ohne Einfluss der Engländer, aufmerken.
Daneben malt Blum Aquarelle von Kircheninterieurs in Trier und in Holland
(Haarlem), die auf einer Sonderausstellung des Erzbischöflichen Diözesanmuseums
(1911) in Köln gezeigt werden.
Als Preisträger eines Wettbewerbes des Kölner Verkehrsvereins (1912) erhält
Blum den Auftrag, 20 Aquarelle von Köln, seinen Bauten und seinen Industrien zu
schaffen, die als ganzseitige Kunstdruckbeilagen in dem im Jahre 1914 aus
Anlass der Werkbund-Ausstellung erschienenen Sammelwerk „Köln in Wort und Bild“
veröffentlicht werden.
Mit diesen Arbeiten schlägt der Künstler ein Thema an, das in den folgenden
Jahrzehnten immer wieder und erneut aufklingen wird: Köln mit seinen vertrauten
oder auch weniger bekannten Straßen, Winkeln und Gassen. Hier liegen die
Wurzeln, dass Theo Blum zum „Heimatmaler“ von Alt-Köln wurde.
Doch noch ein zweites muss verzeichnet werden. Die erste Italien-Reise im
Jahre 1914 brachte den endgültigen Durchbruch zur Landschaftsmalerei. Die
südliche Sonne lässt helle und kräftige Farben wählen; eine Farbskala, die
dann Theo Blum bis heute nicht wieder aufgeben wird.
Der erste Weltkrieg und die Kaltnadelradierung
Die italienische Studienreise, die Theo Blum nach Genua, Rom, Neapel,
Sorrent, Positano, Amalfi, Ravello, Bologna, Siena und Venedig führt und eine
reiche künstlerische Ausbeute bringt, wird jäh unterbrochen durch den Beginn
des ersten Weltkrieges. Als Kriegsmaler der 1. Armee arbeitet Blum in den
Jahren 1915—1918 an dem umfangreichen Kriegswerk von Frankreich, das rund 250
Zeichnungen und Aquarelle umfasst. Es sind ausschließlich
Landschaftsdarstellungen aus den Ardennen und Argonnen, von der Somme und
Champagne. Wohl erscheinen in diesen Arbeiten auch die Auswirkungen des Krieges
mit seinen Zerstörungen, doch das eigentliche kriegerische Geschehen tritt
immer hinter der Landschaftsschilderung zurück.
Interimistisches Zwischenspiel ist die künstlerische Leitung des Theaters
in Charleville und Nouzon, gemeinsam mit dem Architekten Prof. Wilhelm Kreis
und dem Bildhauer Prof. Bruno Vierthaler. Es war hier nicht immer ganz einfach,
wenn statt des plötzlich abgesetzten „Faust“, für den Inszenierung und
Bühnenbild bereits fertiggestellt waren, Gerhart Hauptmanns „Versunkene Glocke“
gegeben werden sollte. Das war im Jahre 1918!
Auch mit dem Papier für Aquarelle und Zeichnungen und für den Druck der
verschiedenen Kriegszeitungen wurde es immer schwieriger. Schließlich war das
Papier so schlecht, dass es kaum noch für bildliche Reproduktionen geeignet
war. Hier brachte es nun ein Zufall mit sich, dass Blum im Jahre 1916 in Cambrai
den an der Kriegszeitung in Charleville tätigen Maler und Radierer Max Brüning
aus Leipzig kennen lernte. Brüning vermittelte die ersten Kenntnisse der
Radiertechnik und überließ Blum mehrere Kupferplatten, Nadeln und Rouletten. So
machte denn Theo Blum aus der Not eine Tugend und begann in der Technik der
kalten Nadel zu radieren, weil es vor allem damals darum ging, mit möglichster
Schnelligkeit für den Zeitungsdruck geeignete ausdrucksvolle Bilder zu
erzielen. — Die Technik der
Kaltnadelradierung wird auch heute noch von Blum gehandhabt.
Deutsche Lande
 Da nach Kriegsende die Grenzen zunächst verschlossen sind, gehen die ersten
Studien- und Wanderfahrten an die Mosel und Saar und nach Pommern an die
Ostsee, bis Tirol und Holland folgen.
Da nach Kriegsende die Grenzen zunächst verschlossen sind, gehen die ersten
Studien- und Wanderfahrten an die Mosel und Saar und nach Pommern an die
Ostsee, bis Tirol und Holland folgen.
Längst ist die geschätzte Radiertechnik
der kalten Nadel zu einem von Blum bevorzugten künstlerischen Ausdrucksmittel
geworden. Die „Brutalität“ früherer Arbeiten unter mehr als notwendiger
Anwendung der verschiedenen Rouletten ist einer feineren und subtileren
Strichführung gewichen, die schließlich die Roulette-Technik ganz aufgibt. Das
erfolgte nicht zuletzt mit durch die kritischen Äußerungen eines Max Creutz.
So
schafft der Künstler im Laufe der Jahrzehnte ein Radierwerk, das bei Ausbruch
des zweiten Weltkrieges rund 200 Platten umfasst. Ein Lebenswerk, das in Berlin
bei einer Kunstdruckanstalt restlos den Bomben des zweiten Weltkrieges zum
Opfer fiel! — In diesen graphischen Blättern waren die Schönheiten der
rheinischen
Heimat, der Eifel-, Mosel- und Saarlandschaft in einer liebevollen Hingabe
gestaltet; naturgebunden und dennoch kein photographisches Klischee.
Anlässlich
einer Graphik-Ausstellung von Blum in Bonn (1940) schrieb einmal Heinrich
Lützeler: „Im Neusehen des oft Gesehenen und in der Entdeckung des oft
Übersehenen
erfüllt sich Blums handwerklich genaue Arbeit; sie gilt der Weite, gilt dem
Harten und Gewaltigen, gilt der Spannung des dunklen Vordergrundes und des
linearklaren Hintergrundes, gilt einer fast verwehenden lichten Feinheit, die
als Symbol höchster Lebensfreude über der Landschaft schwebt. Dazu ist es das
Werk eines ausgesprochen rheinischen Menschen, voll vergeistigter
Sinnlichkeit.“
Der Maler Theo Blum
Neben den bis dahin bevorzugten Techniken der Zeichnung, der Radierung und
des Aquarells entstehen bereits in den frühen zwanziger Jahren die ersten
Ölgemälde mit landschaftlichen Motiven. So hat Theo Blum besonders auf der
zweiten (1924/25) und dritten (1926) Italien-Reise mehrere Ölbilder gemalt. Er
verwendet hierbei vor allem eine breitflächige Spachteltechnik. Vielfach ist
man geneigt, diese Arbeiten einem späten Impressionismus zuzurechnen. Was
jedoch nur zum Teil richtig ist, denn hin und wieder sind ebenfalls
expressionistische Stilelemente zu beobachten. Eines wird aber in den
Landschaftsdarstellungen, Ölbildern und Aquarellen, vor allem offenbar, dass Bluni mit den konventionellen Formen des Akademismus restlos gebrochen hat.
Hinzu kommt, dass die Beschäftigung mit der Ölmalerei sich
ebenfalls auf die Radiertechnik auswirkt. Das zeigen die graphischen
Mappen-Werke „Rom 1925“ und „Aus Roms Umgebung“, besonders aber jene 12
„malerischen“ Radierungen aus der Mappe „Palazzo Chigi und sein Park in
Ariccia“. Allgemein bekannt wird der Künstler durch sein Gemälde „Sommertag in
Zons“, das Hanfstaengel in München als Kunstdruck herausbringt (1928), während
das Originalgemälde der Schweizer Industrielle Winterhalter für seine Sammlung
erwirbt. — Für das geschlossene Rom-Werk erhält Blum die Auszeichnung des päpstlichen
Ordens „Pro Ecclesia et Pontifice“, während die Stadt Zons dem Künstler wegen
seiner Verdienste um die künstlerische Darstellung dieser mittelalterlichen
kurkölnischen Zollfeste das Ehrenbürgerrecht verleiht.
In den Jahren zwischen den beiden Kriegen entsteht so mit Fleiß und in zäher Kleinarbeit ein
umfassendes Werk der Landschaftsdarstellung in Zeichnungen, Aquarellen und
Radierungen. Bevorzugte Motive liegen im Saar- und Moselland, im rheinischen
Raum, aber auch in Lothringen. Holland, Belgien, Frankreich und Italien sind
ebenfalls in zahlreichen Arbeiten vertreten. Immer wieder zieht es den Künstler
nach dem geliebten Süden. Gefüllte Skizzenbücher bringen die vierte
Italienreise (1954) in den Golf von Neapel und nach Ischia und eine
Spanien-Reise im Jahre 1959.
Es bleibt erstaunlich, wenn der Meister — wie ihn die Freunde nennen — von einer Studien
fahrt, um erschauend durch die Welt zu schweifen, zurückgekehrt, nach langer
Zeit abgeschiedenen Schaffens seine neuesten und letzten Arbeiten vorlegt, wie
alle Betrachter immer wieder das Neue der künstlerischen Aussage überrascht.
Theo Blum und Zons
Trotz dieses Schweifens in die Ferne schließt sich für Theo Blum der Kreis immer wieder im
Rheinland, genauer im niederrheinischen Raum. Hier sind es die rheinische
Metropole Köln und das kleine liebenswerte Städtchen Zons, stromabwärts unweit
Köln, denen letztlich seine ganze Liebe gilt. Hier ist er im weitesten Sinne
zum Heimatschilderer geworden. Seine künstlerischen Arbeiten haben mit dazu
beigetragen, das „alte Antlitz“ dieser beiden Städte, mit ihren vertrauten
Winkeln und Gassen, breitesten Kreisen bekannt zu machen; und wenn man den
Namen Theo Blum nennt, klingt damit auch gleichzeitig der Name Zons auf. Theo
Blum ist zwar nicht der einzige Maler, der in Zons gezeichnet und gemalt hat,
aber er ist bis heute in weitem Abstand der Künstler, dessen Schaffen am
stärksten das Erlebnis Zons reflektiert.
Die erste Begegnung mit Zons liegt heute volle sechs Jahrzehnte zurück. Das war im Jahre
1904, als Theo Blum mit jungen, wachen Künstleraugen zum ersten Male durch die
heimeligen Straßen und Gassen dieser Stadt wanderte und die ersten flüchtigen,
aber äußerst impressiven Skizzen entstanden. Ihn, den Niederrheiner, musste
dieses „niederrheinische Idyll“ ganz besonders ansprechen und gefangen nehmen.
Und so sehen wir Theo Blum dann in den Jahren vor und nach dem ersten Weltkrieg
die mauerumwehrte Stadt förmlich einkreisen, bis die Blickpunkte festgelegt
sind, von wo aus der „künstlerische Angriff“ erfolgen kann. So hat er dann
schließlich dieses wundervolle Städtchen „eingenommen“, wie es ihn andererseits
„gefangen“ genommen hat und „gefangen“ genommen hält bis auf unsere Tage.
Theo Blum hat es sich hier in seinem Schaffen und im Erfassen der Motive keineswegs leicht
gemacht und vor allem, was vielleicht sehr nahegelegen hätte, keine falsche und
süßliche Ansichtskarten-Romantik aufkommen lassen. Die flotten,
impressionsstarken Bleistift- und Tintenstiftzeichnungen, die äußerst feinfühlig
in einer subtilen Strichführung mit der kalten Nadel gestalteten Radierungen
und die temperamentvoll gespachtelten Gemälde schildern Zons ohne jedes falsche
Pathos und ohne den falschen „mittelalterlichen Ruch“ der Historienmalerei.
Seine Bilder schildern Zons so, wie es ist, und in allen lebt und schwingt die
Atmosphäre dieser Stadt.
Unübertroffen bleibt das Gemälde „Sommertag in Zons“ aus dem Jahre 1925, das der Schweizer
Industrielle Winterhalter für seine Sammlung erwarb und die bekannte Kunstdruckanstalt
Hanfstaengel, München, im Jahre 1928 als farbigen Kunstdruck herausbrachte. In
diesem Bild hat Theo Blum mit breitem Spachtel und in einer äußerst delikaten,
harmonischen und sparsamen Farbenwahl sein künstlerisches Erlebnis Zons
niedergeschrieben und damit diese — bis heute — einzigartige künstlerische
Aussage von dieser Stadt geschaffen. In einer breit angelegten Symphonie klingt
mit vertikaler Beherrschung das Hauptmotiv des mächtigen Rheinturmes auf und
schwingt aus in der leichten Horizontalen der alten Stadtmauer mit den Akzenten
der Wehrtürme, um nochmals vertikal aufzuklingen in jenen aufsteigenden Bäumen
am linken Bildrand. Hier offenbart sich im gewählten Blickpunkt, im
getroffenen, begrenzten Ausschnitt und im breitflächig, farbig-malerisch
kompositorischen Bildaufbau die Meisterschaft des Künstlers in einer melodisch
beschwingten Wirkung, die wohl kaum noch übertroffen werden kann. Damit hat
aber Theo Blum das auch heute noch gültige Bild von Zons geschaffen, und in
seinem künstlerischen Schaffen nimmt diese Stadt ein besonderes Kapitel ein.
Ausklang
Theo Blum ist Zons zu Dank verpflichtet und Zons ist Theo Blum zu Dank verpflichtet. Einmal
waren es gerade die Arbeiten von Zons, die zahlreichen Zeichnungen, Radierungen
und Aquarelle, besonders aber jenes Gemälde „Sommertag in Zons“, das den Namen
des Künstlers in alle Lande trug; zum anderen waren es gerade die Bilder Theo
Blums von Zons, welche die Öffentlichkeit wieder auf dieses alte "niederrheinische
Idyll“ aufmerksam gemacht haben, dass Zons ein geschätztes Reise- und
Wanderziel wurde. In der Tat eine schöne Wechselseitigkeit der Wirkungen und
Beziehungen, die heute nun schon viele Jahrzehnte zwischen der Stadt und dem
Künstler Theo Blum bestehen.
Dr. Werner JÜTTNER
( )
)
Anmerkung
Ein weiteres Zeichen der Zuneigung des hoch geachteten und beliebten Landschaftsmalers für die Stadt Zons folgte kurz vor seinem Tod: Per Erbvertrag vom 9. August 1967 vermachte er sein Gesamtwerk der damals selbständigen Stadt Zons. Ein schönes und wertvolles Geschenk. Allein das grafische Werk zählt nahezu 3.000 Blätter; hinzu kommen Dutzende von Ölgemälden.
Im Juni 1974 ging das Vermächtnis des Künstlers zunächst auf den Kreis Grevenbroich über, ein halbes Jahr später dann auf den Kreis Neuss. Mit der Kommunalen Neugliederung war die Sammlung seiner auf den Kreis Neuss übergegangenen, der es im Kreismuseum unterbrachte. Mittlerweile ist das Werk jedoch zurück an die Stadt Dormagen gegangen.
Theo Blum starb am 31. Januar 1968 in Köln.
( )
)